In Deutschland stellen kardiovaskuläre Erkrankungen die häufigste Todesursache dar: Etwa ein Drittel aller Sterbefälle ist auf Herz-Kreislauf-Erkrankungen zurückzuführen.1 Besonders relevant ist die Herzinsuffizienz, die umgangssprachlich auch als Herzschwäche bezeichnet wird.
Rund vier Millionen Menschen in Deutschland sind von der Erkrankung betroffen – das ist mehr als jede 20. Person.2 Die Begriffe Herzinsuffizienz, Herzschwäche und Herzmuskelschwäche haben dieselbe Bedeutung: Aufgrund einer Schwächung des Herzmuskels kann das Herz nicht mehr ausreichend Blut durch den Körper pumpen, es kommt zu einer verminderten Blutversorgung der Organe.3
Johannes Hinrich von Borstel, Autor und Science-Slammer, über die Mythen der Herzinsuffizienz
Mythos 1
Das Herz hört bei einer Herzinsuffizienz auf zu schlagen
Die Herzinsuffizienz tritt meist als Folge einer Herzmuskel- oder Herzklappenschädigung auf. Beide beeinträchtigten die Pumpleistung des Herzens und führen so zu einer chronischen Herzschwäche.2 Trotz der eingeschränkten Pumpleistung schlägt das Herz aber weiter. Anders ist es bei einem Herzstillstand, der auch als plötzlicher Herztod bezeichnet wird: Ihm gehen schwere Herzrhythmusstörungen voraus, nach wenigen Minuten kommt es zu einem plötzlichen Stillstand des Herzens.4
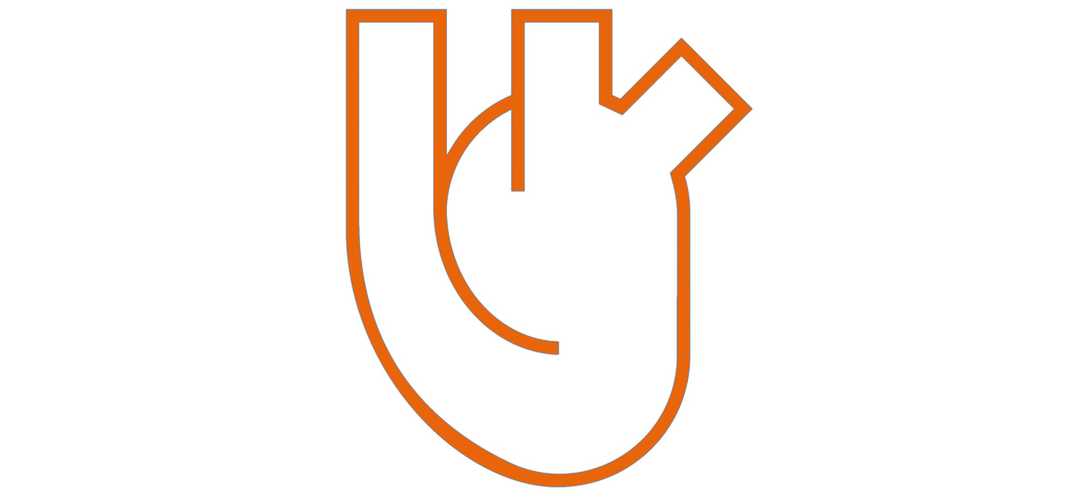
Mythos 2
Herzinsuffizienz ist das „Ende der Straße“ und kann nicht behandelt werden
Richtig ist, dass die Herzinsuffizienz nach derzeitigem Stand nicht heilbar ist und die Wahrscheinlichkeit für Patienten und Patientinnen bei 50 Prozent liegt, die nächsten fünf Jahre nach der Diagnosestellung zu überleben.5 Das Fortschreiten der Erkrankung kann jedoch verzögert werden. Je nach Diagnose und Schwere der Erkrankung gibt es verschiedene Bausteine, die zum Einsatz kommen können. Ein Baustein in der Behandlung der Herzschwäche ist die medikamentöse Therapie.

Hierfür gibt es mittlerweile viele Behandlungsoptionen, die begleitende Symptome lindern, den Krankheitsverlauf verlangsamen und die Lebensspanne sowie die Lebensqualität teils deutlich verbessern können. Ganzheitliche Ansätze wie zum Beispiel ein Lebensstil mit ausreichend Bewegung oder chirurgische Eingriffe können die medikamentöse Therapie komplementieren.2, 6
Die Diagnose Herzinsuffizienz kann das Leben verändern. Patientenorganisationen sind dann eine wertvolle Anlaufstelle: Sie können Betroffene in allen Phasen der Erkrankung bei Fragen gezielt beraten und Unterstützung bieten.
Mythos 3
Man darf sich körperlich nicht mehr belasten
Es ist ein weitverbreiteter Mythos, dass bei Herzschwäche Schonung empfohlen wird. Im Gegenteil: Regelmäßige Bewegung im richtigen Maß ist wichtig, um das Herz zu trainieren und zu stärken, die Durchblutung zu fördern sowie Symptome zu lindern. Auch kleinere Sporteinheiten schützen das Herz und stärken außerdem Muskulatur und Knochen. Bei einer stabilen Herzinsuffizienz eignet sich ein leichtes Training mit dynamischer Bewegung und wenig Kraftaufwand: Ideal sind zum Beispiel Nordic Walking, Radfahren und Wandern.

Menschen mit einer fortgeschrittenen Herzschwäche können von leichten Aktivitäten wie Gehen und Treppensteigen profitieren. Wichtig ist: Eine solche Bewegungstherapie sollten Sie nur unter ärztlicher Kontrolle beginnen. Wird sie gut vertragen, können Patienten und Patientinnen das Training beziehungsweise die Bewegungsform zu Hause fortsetzen.2, 7
Mythos 4
Herzinsuffizienz tritt ohne Warnzeichen auf
Eine Herzinsuffizienz ist nicht immer klar und deutlich zu erkennen, denn die Symptome sind vielfältig und können sich sowohl in ihrer Art als auch in ihrer Ausprägung zwischen den Betroffenen stark unterscheiden. Ein typisches Symptom, das auf eine Herzinsuffizienz hindeuten kann, ist Atemnot: Sie macht sich bei Belastung wie etwa beim Sport und beim Treppensteigen bemerkbar. Aber auch Müdigkeit, nachlassende Leistungsfähigkeit, Wassereinlagerungen zum Beispiel in den Beinen und Füßen sowie Gewichtszunahme können Anzeichen einer Herzschwäche sein. Zusätzlich können mit Husten, kalten Gliedmaßen oder nächtlichem Harndrang auch weniger typische Symptome auftreten.3
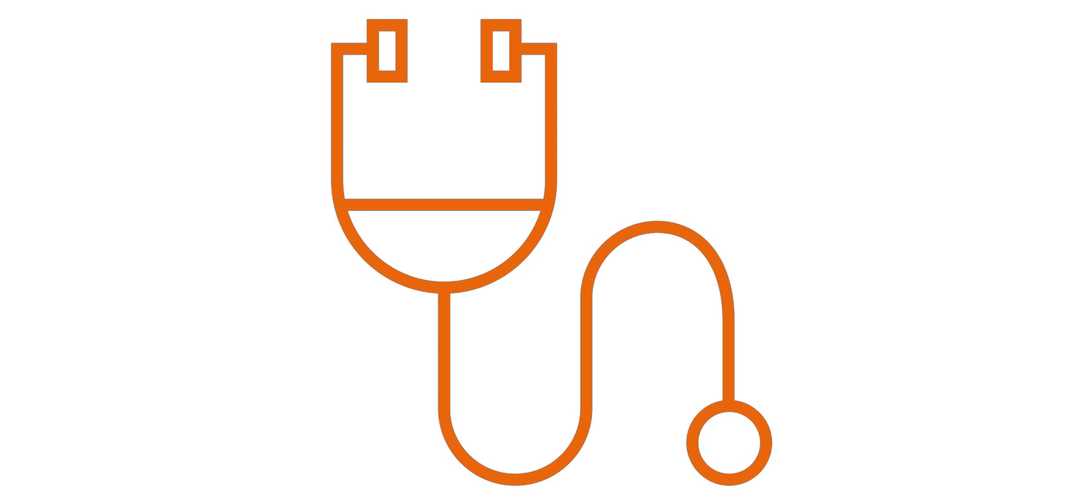
In jedem Fall gilt: Treten derartige Warnzeichen auf, sollten diese ernstgenommen und so bald wie möglich durch einen Arzt oder eine Ärztin abgeklärt werden. Für eine erste Einschätzung, ob Beschwerden auf eine Herzinsuffizienz hindeuten, eignen sich Selbsttests wie der Deutsche Herzinsuffizienz-Test (DeHiT). Er ist beispielsweise online unter www.ratgeber-herzinsuffizienz.de verfügbar.8 Der wissenschaftlich fundierte Test umfasst zwölf Fragen.9 Wichtig: Der Selbsttest ersetzt keine Untersuchung oder Diagnose, sondern bietet eine gute Grundlage, die Testergebnisse mit dem Arzt oder der Ärztin zu besprechen.
Mythos 5
Die Symptome sind Begleiterscheinungen des normalen Alterungsprozesses
In vielen Fällen handelt es sich bei Symptomen wie Kurzatmigkeit, Erschöpfung oder geschwollenen Beine nicht um bloße Alterserscheinungen. Doch vor allem ältere Menschen nehmen erste Symptome einer Herzschwäche häufig nicht ernst. Dies kann fatal sein: Auch wenn die Erkrankung nicht immer klar erkennbar ist, so schreitet sie stetig voran. Insbesondere zu Beginn der Herzinsuffizienz entwickelt der Körper verschiedene Strategien, um die schlechte Pumpleistung des Herzens für eine Weile auszugleichen, also zu kompensieren.

Oftmals wird die Diagnose deshalb erst gestellt, wenn die Erkrankung schon fortgeschritten ist. Unabhängig vom Alter ist es daher umso wichtiger, die Symptome einer Herzschwäche nicht zu unterschätzen und gegebenenfalls eine frühzeitige Diagnose und Behandlung zu ermöglichen.3
Mythos 6
Herzinsuffizienz betrifft nur ältere Menschen
Auch jüngere Menschen können eine Herzinsuffizienz entwickeln. In einer Studie des Deutschen Zentrums für Herzinsuffizienz (DZHI) befand sich etwa jede dritte Person zwischen 30 und 39 Jahren in einem Vorstadium für eine Herzschwäche, bei der entweder mindestens ein Risikofaktor wie Bluthochdruck, Übergewicht, Diabetes und Arteriosklerose vorhanden war oder im Ultraschall eine sichtbare Veränderung der Herzstruktur gefunden wurde.10, 11

Ein solches Vorstadium führt nicht zwangsläufig zu einer Herzschwäche, sollte als Warnzeichen jedoch ernst genommen werden, um das Risiko für Folgeerkrankungen zu reduzieren.11
Mythos 7
Die tägliche Salzmenge sollte stark reduziert werden
Die meisten Menschen nehmen täglich mehr als die empfohlenen 5 bis 6 Gramm Salz zu sich.12, 13 Das liegt vor allem an Lebensmitteln wie Brot, Wurst, Käse und Fertigprodukten, in denen sich viel Salz versteckt.14, 15 Personen mit einer Herzschwäche müssen nicht komplett auf Salz verzichten. Eine internationale Studie, die in sechs Ländern durchgeführt wurde, zeigte sogar: Patienten und Patientinnen mit Herzinsuffizienz profitierten nicht davon, wenn die tägliche Natriumzufuhr auf rund 1,5 Gramm (das entspricht etwa 3,8 Gramm Kochsalz) beschränkt wurde.16
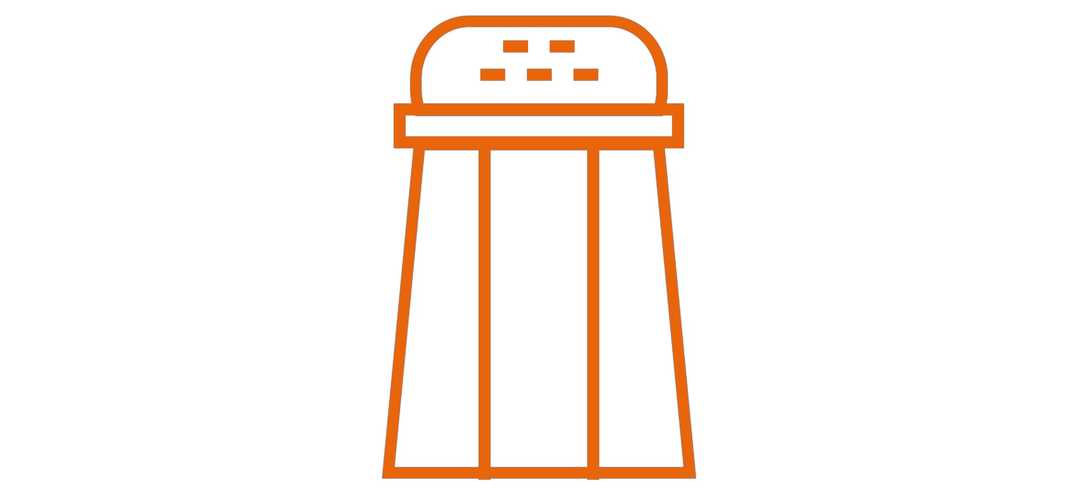
Die im August 2021 aktualisierte europäische Leitlinie zur Therapie von Menschen mit Herzinsuffizienz empfiehlt, bei Herzschwäche nicht mehr als 5 Gramm Salz (das entspricht etwa einem Teelöffel) pro Tag mit der Nahrung zu sich zu nehmen.17 Am besten gelingt dies, wenn möglichst wenige stark gesalzene Lebensmittel und Fertigprodukte verzehrt werden.15
Mythos 8
Bei Herzinsuffizienz ist eine Flüssigkeitsrestriktion erforderlich
Im Update der europäischen Herzinsuffizienz-Leitlinie wird bei einer leichten bis mittelschweren Form der Herzschwäche keine Einschränkung der Flüssigkeitszufuhr empfohlen.17 Anders ist es bei Betroffenen mit einer schweren Form der Herzinsuffizienz: Hier kann eine Flüssigkeitsrestriktion auf 1,5 bis 2 Liter täglich in Betracht gezogen werden, um Wassereinlagerungen und damit verbundene Symptome wie Bluthochdruck oder Atemnot zu lindern.15, 17

In besonderen Situationen, wie etwa bei Hitze oder Erbrechen, kann die Trinkmenge leicht erhöht werden, um eine Dehydrierung zu vermeiden.17 Idealerweise besprechen Betroffene die Flüssigkeitszufuhr mit ihrem Arzt oder ihrer Ärztin. Übrigens: Auch der Verzehr von Suppen und stark wasserhaltigen Obst- und Gemüsesorten hat einen Einfluss auf die tägliche Flüssigkeitsmenge.14
Mythos 9
Herzinsuffizienz ist dasselbe wie ein Herzinfarkt
Obwohl Herzinsuffizienz und Herzinfarkt beide unter die Kategorie der Herz-Kreislauf-Erkrankungen fallen, unterscheiden sie sich stark. Bei einem Herzinfarkt kommt es zum plötzlichen Verschluss in einem der Herzkranzgefäße, sodass die Blutzufuhr zu einem Bereich des Herzmuskels stark verringert oder unterbrochen ist.18 Die Herzinsuffizienz dagegen ist eine chronische, fortschreitende Erkrankung, bei der das Herz nicht in der Lage ist, effizient zu pumpen und den Körper ausreichend mit Blut und Sauerstoff zu versorgen.

Dies führt zu typischen Symptomen wie Atemnot bei Belastung und stark geschwollenen Beinen. Eine Herzinsuffizienz kann jedoch die Folge eines Herzinfarktes sein.
Übrigens: Herzinsuffizienz ist nicht gleich Herzinsuffizienz. Je nachdem, welcher Bereich des Herzens wie lange und in welcher Funktion geschwächt ist, sprechen Fachleute von verschiedenen Formen der Erkrankung. So gibt es beispielsweise die chronische und die akute Herzinsuffizienz und darüber hinaus, je nachdem, welche Herzhälfte nicht mehr richtig arbeitet, die Linksherzinsuffizienz und die Rechtsherzinsuffizienz.3
Mythos 10
Ein Herzversagen lässt sich nicht verhindern
Eine Herzinsuffizienz ist zwar nicht heilbar, aber je früher sie erkannt wird, desto besser sind die Behandlungsmöglichkeiten - und desto eher lassen sich ihr Fortschreiten bremsen beziehungsweise kontrollieren und auch die Lebenserwartung und Lebensqualität der Betroffenen verbessern.3
Medikamentöse Behandlungsoptionen können helfen, das Herz zu entlasten.19 Gezielte Bewegung, etwa leichtes bis moderates Ausdauertraining, gilt mittlerweile als weiterer wichtiger Baustein in der Therapie der Herzinsuffizienz.19

Zusätzlich können bereits kleine Änderungen der Lebensweise ein Fortschreiten der Erkrankung hinauszögern, die Symptome lindern und das Risiko für ein kardiovaskuläres Ereignis minimieren. Betroffene sollten zum Beispiel den Alkoholkonsum reduzieren oder ganz einzustellen, mit dem Rauchen aufhören, körperlich aktiv sein und sich herzgesund mit viel frischem Gemüse, wenig Zucker und wenigen stark gesalzenen Lebensmitteln und Fertigprodukten ernähren.14,16
Quellen
1 Statistisches Bundesamt. Pressemitteilung Nr. 505 vom 4. November 2021. Abrufbar unter: https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2021/11/PD21_505_23211.html, zuletzt aufgerufen am 17.02.2025.
2 Deutsche Herzstiftung e. V. Herzschwäche: Symptome und Therapie. Abrufbar unter: https://www.herzstiftung.de/infos-zu-herzerkrankungen/herzinsuffizienz, zuletzt aufgerufen am 17.02.2025.
3 Deutsche Herzstiftung e. V. Herzschwäche: Symptome sind oft unspezifisch. Abrufbar unter: https://www.herzstiftung.de/infos-zu-herzerkrankungen/herzinsuffizienz/symptome, zuletzt aufgerufen am 17.02.2025.
4 Deutsches Zentrum für Herz-Kreislauf-Forschung e. V.: Plötzlicher Herztod. URL: https://dzhk.de/erkrankungen/ueberblick/ploetzlicher-herztod, zuletzt aufgerufen am 17.02.2025.
5 Müller-Werdan U, Werdan K. Chronische Herzinsuffizienz: Die Zahl der Patienten steigt, aber auch die differenzierter Therapien. Dtsch Arztebl 2016;113(25): A-1207. Abrufbar unter: https://www.aerzteblatt.de/archiv/180274/Chronische-Herzinsuffizienz-Die-Zahl-der-Patienten-steigt-aber-auch-die-differenzierter-Therapien, zuletzt aufgerufen am 17.02.2025.
6 Kompetenznetz Herzinsuffizienz. Möglichkeiten der Behandlung. Abrufbar unter: http://knhi.de/patients/behandlung, zuletzt aufgerufen am 17.02.2025.
7 Gesundheitsinformation.de. Herzschwäche – Helfen Sportprogramme, fit zu bleiben? Abrufbar unter: https://www.gesundheitsinformation.de/helfen-sportprogramme-fit-zu-bleiben.html, zuletzt aufgerufen am 17.02.2025.
8 Ratgeber Herzinsuffizienz. Selbsttest Herzinsuffizienz. Abrufbar unter: https://www.ratgeber-herzinsuffizienz.de/erkennen/selbsttest, zuletzt aufgerufen am 17.02.2025.
9 Edel K et al: Fragebogen zur frühen Detektion von Herzinsuffizienz DeHiT (Deutscher Herzinsuffizienz-Test). Diabetologie und Stoffwechsel 2019;14(Suppl 1):14.
10 Morbach C et al. Prevalence and determinants of the precursor stages of heart failure: results from the population-based STAAB cohort study. Eur J Prev Cardiol 2021;28(9):924–934.
11 Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF): Würzburger Studie: Vorstufen einer Herzschwäche bei auffallend vielen jungen Menschen. Abrufbar unter: https://www.gesundheitsforschung-bmbf.de/de/wurzburger-studie-vorstufen-einer-herzschwache-bei-auffallend-vielen-jungen-menschen-11615.php, zuletzt aufgerufen am 17.02.2025.
12 Weltgesundheitsorganisation (World Health Organization, WHO): Salt intake. Abrufbar unter: https://www.who.int/data/gho/indicator-metadata-registry/imr-details/3082, zuletzt aufgerufen am 17.02.2025.
13 Deutsche Gesellschaft für Ernährung e. V. (DGE e. V.). Ausgewählte Fragen und Antworten zu Speisesalz. Abrufbar unter: https://www.dge.de/wissenschaft/faqs/salz/#c2591, zuletzt aufgerufen am 17.02.2025.
14 Kompetenznetz Herzinsuffizienz. Gesundheitsunterstützende Maßnahmen. Abrufbar unter: http://knhi.de/patients/gesundheitsunterstutzende-masnahmen, zuletzt aufgerufen am 17.02.2025.
15 Programm für Nationale VersorgungsLeitlinien in der Trägerschaft von Bundesärztekammer (BÄK), Kassenärztlicher Bundesvereinigung (KBV) und Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften (AWMF): Herzschwäche: Muss ich auf meine Ernährung achten? URL: https://register.awmf.org/assets/guidelines/Nationale_Versorgungs-Leitlinie/nvl-006pi5_S3_Chronische_Herzinsuffizienz_2019-10.pdf, zuletzt aufgerufen am 17.02.2025.
16 Ezekowitz JA et al. Reduction of dietary sodium to less than 100 mmol in heart failure (SODIUM-HF): an international, open-label, randomised, controlled trial. Lancet 2022;399(10333):1391–1400.
17 McDonagh TA et al. 2021 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure: Developed by the Task Force for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure of the European Society of Cardiology (ESC) With the special contribution of the Heart Failure Association (HFA) of the ESC. Eur Heart J 2021;42:3599–3726.
18 MSD Manuals: Akute Koronarsyndrome (Herzinfarkt, Myokardinfarkt, instabile Angina pectoris). URL: https://www.msdmanuals.com/de-de/heim/herz-und-gef%C3%A4%C3%9Fkrankheiten/koronare-herzkrankheit/akute-koronarsyndrome-herzinfarkt-myokardinfarkt-instabile-angina-pectoris, zuletzt aufgerufen am 17.02.2025.
19 Deutsche Herzstiftung e. V. Therapie der Herzschwäche: Worauf kommt es an? Abrufbar unter: https://www.herzstiftung.de/infos-zu-herzerkrankungen/herzinsuffizienz/behandlung-und-therapie/worauf-kommt-es-an, zuletzt aufgerufen am 17.02.2025.

