Sie sind bisher noch nicht mit dem Thema Herzschwäche in Berührung gekommen? Dann ist es verständlich, dass sich viele Fragen stellen, wenn Sie selbst davon betroffen sind oder eine angehörige Person.
Hier finden Sie Antworten auf häufige Fragen – von der Entstehung bis zur Behandlung der Erkrankung.
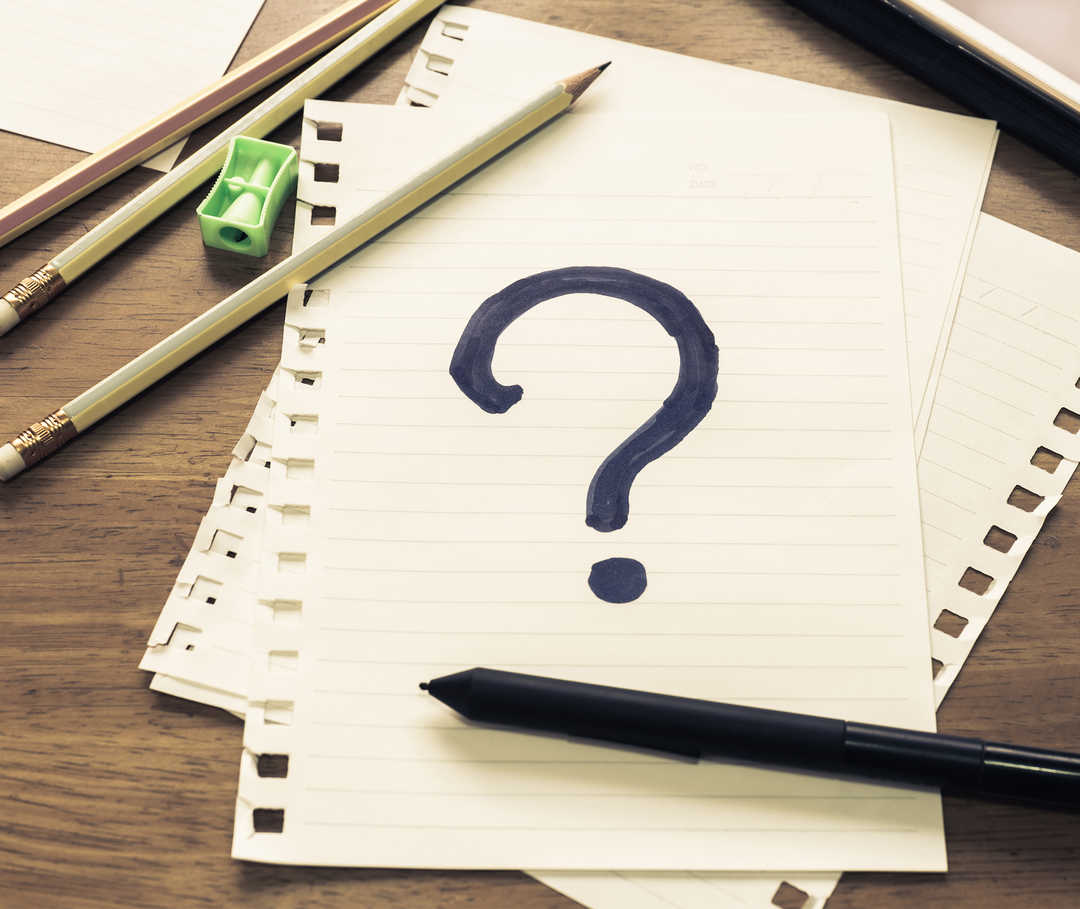
AdobeStock_108638719_patpitchaya
Fragen zur Herzschwäche beantwortet zu bekommen, ist der erste Schritt um die Erkrankung besser zu verstehen und damit umzugehen.
Was ist eine Herzschwäche?
Eine Herzschwäche wird medizinisch als Herzinsuffizienz bezeichnet. Die Funktion des Herzens ist dabei aus den unterschiedlichsten Gründen gestört und beeinträchtigt die Pumpleistung des Herzmuskels. Dieser schafft es nicht mehr genügend Blut durch den Körper zu pumpen und ihn so ausreichend mit Sauerstoff und Energie zu versorgen. Da sich das Herz in eine linke und rechte Hälfte unterteilt, kann die verminderte Pumpleistung sowohl von der rechten als auch von der linken Herzkammer ausgehen.
Sie wollen mehr erfahren? Lesen Sie den Artikel: „Was ist eine Herzinsuffizienz?"
Welche Formen der Herzschwäche gibt es?
Die verschiedenen Formen der Herzschwäche geben darüber Auskunft, welcher Bereich des Herzens wie lange und in welcher Funktion geschwächt ist. Möglich sind
- Formen, die den Ort der Herzschwäche beschreiben (Linksherzinsuffizienz, Rechtsherzinsuffizienz und globale Herzinsuffizienz),
- Formen, die Rückschlüsse auf die Dauer und Entstehungszeit der Herzschwäche zulassen (akute Herzschwäche und chronische Herzschwäche),
- Formen, die Aufschluss darüber geben, welche Funktion des Herzens genau gestört ist (systolische oder diastolische Herzinsuffizienz).
Hier erhalten Sie einen detaillierten Überblick über die einzelnen Formen der Herzinsuffizienz.
Wie häufig und in welchem Alter tritt Herzschwäche auf?
In Deutschland haben etwa zwei Millionen Menschen eine Herzschwäche. Die Wahrscheinlichkeit, daran zu erkranken, steigt mit zunehmendem Alter an. Laut aktuellen Zahlen wird eine von fünf 40-jährigen Personen in ihrem Leben damit zu tun bekommen. Junge Menschen kann die Herzschwäche allerdings auch treffen, etwa durch einen angeborenen Herzfehler oder als Folge einer Herzmuskelentzündung.
Was sind die Ursachen der Herzschwäche?
Zu den häufigsten Ursachen und Risikofaktoren zählen:
- Verkalkung der Herzkranzgefäße (koronare Herzkrankheit)
- vorangegangener Herzinfarkt
- nicht oder unzureichend behandelter Bluthochdruck
- Lungenerkrankungen
- Erkrankungen des Herzens wie eine Herzmuskelentzündung, Herzrhythmusstörung oder Herzklappenerkrankung oder ein angeborener Herzfehler
- Alkohol- und Drogenmissbrauch
Was sind die Anzeichen einer Herzschwäche?
Die Herzschwäche kann zu Beginn noch ohne erkennbare oder merkliche Symptome verlaufen, weil der Körper zunächst dazu in der Lage ist, die verringerte Leistung des Herzens auszugleichen. Zudem interpretieren viele Betroffene auftretende Beschwerden fälschlicherweise als normale Alterserscheinungen. Schreitet die Erkrankung weiter fort, sind verschiedene Symptome mit unterschiedlicher Ausprägung typisch:
- Kurzatmigkeit und/oder Atemnot
- Müdigkeit, Abgeschlagenheit und Konzentrationsstörungen
- geschwollene Füße oder Beine durch Wassereinlagerungen
- plötzliche unbegründete Gewichtszunahme durch Wassereinlagerungen (innerhalb weniger Wochen)
- häufiges nächtliches Wasserlassen
- Druck auf der Brust oder Schmerzen in der Brust
- Atemschwierigkeiten im flachen Liegen
- häufiges Aufwachen durch Hustenreiz in der Nacht
- Schwindel oder Benommenheit
- Appetitlosigkeit, Verstopfung und Völlegefühl
Herzschwäche-Risiko testen
Herzschwäche-Risiko testen

AdobeStock_142518379_Yakobchuk Olena
Ist Herzschwäche vererbbar?
Ja und nein. Zwar wird die Herzschwäche nicht direkt vererbt. Doch die Risikofaktoren, die zu einer Herzschwäche führen, können über das Erbgut weitergegeben werden. Dazu zählt beispielsweise die Neigung zu Herzmuskelerkrankungen oder Bluthochdruck. Hier lesen Sie mehr über die Rolle der Vererbung.
Kann man einer Herzschwäche vorbeugen?
Durch den eigenen Lebensstil können Sie einiges dafür tun, einer Herzschwäche vorzubeugen und Ihr Erkrankungsrisiko gering zu halten. Folgende Maßnahmen helfen dabei, das Herz möglichst lange gesund zu erhalten und bei einer bestehenden Herzschwäche den Krankheitsverlauf positiv zu beeinflussen:
- gesunde und bewusste Ernährung
- regelmäßige Bewegung
- Verzicht auf Zigaretten und übermäßigen Alkoholkonsum
- Vermeidung von Stress: Bemühen Sie sich, Belastungen zu verringern und ein positives Lebensgefühl zuzulassen – denn Lachen sorgt nicht nur für gute Stimmung, es ist auch gut für das Herz.
Lesen Sie auch: 5 Tipps für den Alltag oder Verschlechterung einer Herzschwäche vorbeugen.
Wie wird Herzschwäche behandelt?
Eine Herzschwäche sollte möglichst ganzheitlich behandelt werden. Sowohl die ärztlich begleitete Therapie als auch das persönliche Umfeld und der individuelle Umgang mit der Behandlung spielen für die betroffene Person eine wichtige Rolle. Meist verordnen Ärzte und Ärztinnen verschiedene Medikamente, die sie individuell auf Betroffene und ihren Gesundheitszustand abstimmen. Ist die Herzschwäche schon weit fortgeschritten, ziehen Mediziner und Medizinerinnen möglicherweise auch eine Operation in Betracht. Diese soll das Herz bei seiner Arbeit unterstützen – zum Beispiel durch das Einsetzen eines Schrittmachers oder Defibrillators.
Wie finde ich die richtige Anlaufstelle?
Betroffenen und Angehörigen stehen verschiedene Ansprechpersonen zur Verfügung. Das können Ärzte und Ärztinnen sowie Ernährungsberater und Ernährungsberaterinnen sein. Zudem können physiotherapeutische und psychologische Einrichtungen Unterstützung bieten. Sozialdienst und Selbsthilfegruppen sind weitere wichtige Stützen beim Bewältigen einer Herzschwäche.
Wenn Sie bei sich mögliche Symptome der Herzschwäche entdecken, ist der Hausarzt oder die Hausärztin zunächst die richtige Anlaufstelle, um Ihre Vermutung zu überprüfen. Für eine zweifelsfreie Diagnose der Erkrankung stehen ihnen wie auch und dem Kardiologen und Kardiologin verschiedene Untersuchungsmethoden zur Verfügung:
- Abhören des Brustkorbs
- Ultraschall-Untersuchung des Herzens (Echokardiographie)
- Elektrokardiogramm (EKG; in Ruhe und unter Belastung)
- Röntgen-Untersuchung des Brustkorbs
- Herzkatheter-Untersuchung
Aus den Ergebnissen der Untersuchungen, den beschriebenen Symptomen und äußerlich sichtbaren Anzeichen wie den Wassereinlagerungen an Bauch und/oder Beinen können Ärzte und Ärztinnen Rückschlüsse auf den Zustand des Herzens ziehen – und falls nötig mit einer geeigneten Behandlung beginnen.
Ein aktives Leben bewahren ist oberstes Behandlungsziel. Wie das geht & was Sie selbst tun können.
