Bei der Herzdiagnostik kommen verschiedene Techniken zum Einsatz. Üblich sind EKG, Ultraschall, Blutwertanalyse und Röntgenaufnahmen. Manchmal kann eine Herzkatheter-Untersuchung, eine Radionuklidventrikulographie oder ein Lungenfunktionstest sinnvoll sein. Was passiert bei diesen Methoden und welche Herzuntersuchungen gibt es noch?

AdobeStock_31465702_Alexander Raths
Herzuntersuchungen setzen sich aus vielen Methoden zusammen.
Herzdiagnostik: Am Anfang stehen Anamnese und körperliche Untersuchung
Verschiedene Symptome wie Müdigkeit, Atemnot oder Wassereinlagerungen (Ödeme) deuten auf eine Herzinsuffizienz hin. Wenn eine Person mit diesen Anzeichen zum Arzt oder zur Ärztin kommt, ist eine ausführliche Anamnese der erste Schritt, um die genauen Ursachen herauszufinden.
Mediziner und Medizinerinnen führen dabei eine intensive Befragung durch. Typische Fragen bei einem Anamnesegespräch sind:
- Welche Symptome treten auf?
- Wie lange bestehen die Beschwerden bereits?
- In welchen Situationen treten die Symptome auf?
- Gibt es in der Familie eine Krankheitsgeschichte?
- Kommen momentan familiäre oder seelische Belastungen vor?
Darauf folgt eine körperliche Untersuchung: Ärzte und Ärztinnen messen Puls, Blutdruck, Gewicht, Größe und hören mit dem Stethoskop Herz sowie Lunge ab. Wichtig für die Herzdiagnostik sind zudem die Hautfarbe und -temperatur der Patienten und Patientinnen, weil sie zeigen, wie gut der Körper durchblutet ist. Auch eventuell vorhandene Wassereinlagerungen (Ödeme) sind bei der Untersuchung von Bedeutung.
Nach der körperlichen Untersuchung kommen unter Umständen weitere technische Methoden zum Einsatz.
Echokardiographie (Ultraschalluntersuchung)
Die Ultraschalluntersuchung (Echokardiographie) ist eine häufig angewandte Methode, mit der sich Ärzte und Ärztinnen das Herz genauer ansehen können. Die Untersuchung ist für Patienten und Patientinnen schmerzfrei und dauert etwa 10 bis 15 Minuten.1
Mediziner und Medizinerinnen tragen Kontaktgel auf die Brust auf und fahren dann vorsichtig mit dem Ultraschallkopf darüber. Das Bild ist auf einem Bildschirm des Ultraschallgeräts zu sehen und gibt Aufschluss über
- die Dicke der Herzwand,
- die Größe der Herzkammern,
- die Funktion der Herzklappen sowie
- die Pumpleistung des Herzens.
In manchen Fällen ist es bei der Echokardiographie nötig, das Herz unter Belastung zu sehen. Patienten und Patientinnen müssen sich in diesem Fall vorher für kurze Zeit bewegen oder bekommt ein pulssteigerndes Medikament.
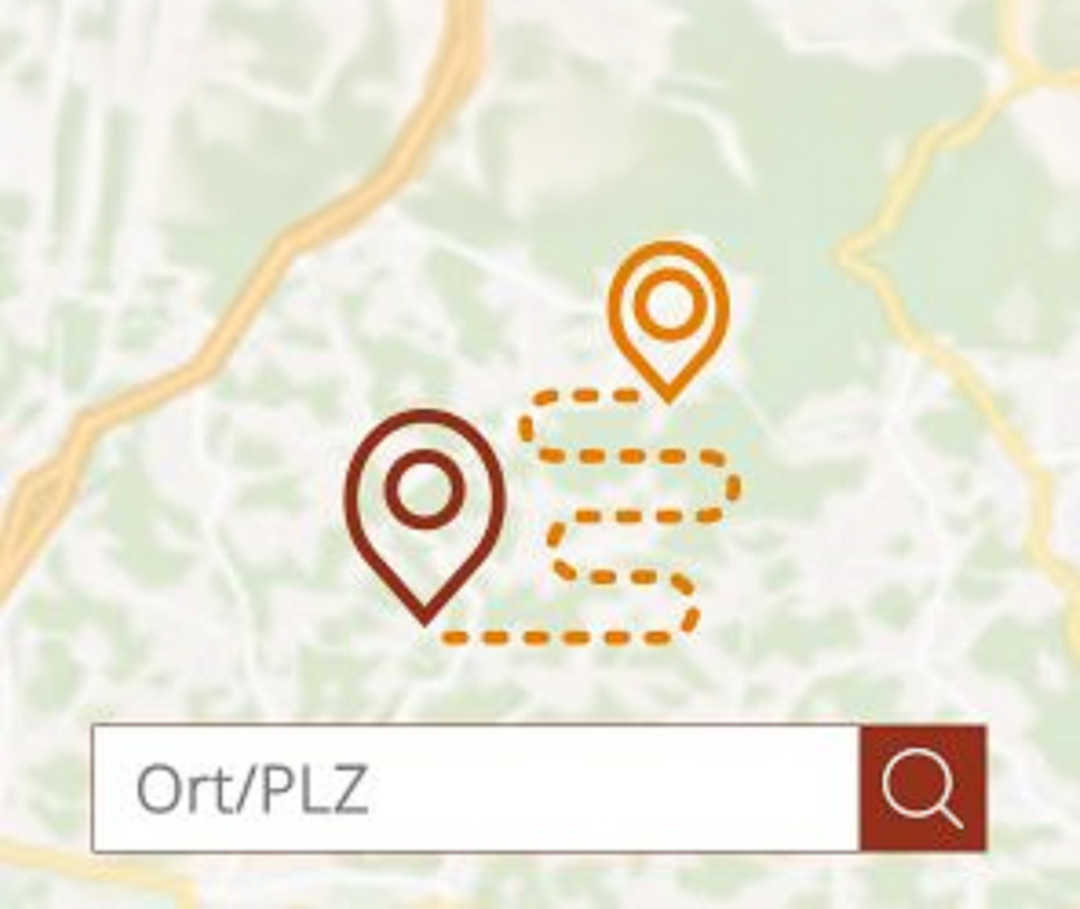
Novartis
Finden Sie Spezialisten und Spezialistinnen in Ihrer Nähe!
Elektrokardiogramm (EKG)
Das Elektrokardiogramm, kurz EKG, gehört zu den wichtigsten Untersuchungsmethoden des Herzens.
Beim EKG bekommen Patienten und Patientinnen Elektroden auf die Brust, die Handgelenke und die Fußknöchel geklebt, die den Herzschlag sowie die elektrische Aktivität des Herzens messen. Am Aufzeichnungsgerät erscheinen die gemessenen elektrischen Impulse als sogenannte EKG-Kurven. Das EKG zeigt neben der Pulsfrequenz und der Regelmäßigkeit des Herzschlags auch, ob
- die Person bereits einen Herzinfarkt erlitten hat,
- eine zu geringe Durchblutung des Herzens vorliegt,
- das Herz unter großer Last arbeitet oder
- es vergrößert ist.
Das EKG ist schmerzfrei und dauert etwa fünf Minuten.2,3 Beim Langzeit-EKG bekommen Patienten und Patientinnen ein mobiles EKG-Gerät mit nach Hause, das über einen Zeitraum von 24 Stunden die Herztätigkeit aufzeichnet. Das Gerät bringen sie in der Regel am nächsten Tag zur ärztlichen Praxis, wo die Daten ausgewertet werden. Ärzte und Ärztinnen können so besser beurteilen, ob möglicherweise eine Herzinsuffizienz vorliegt.
Weitere Methoden zur Herzdiagnostik: Blut- und Urinuntersuchungen
Bei einer umfassenden Herzdiagnostik kommen auch Blut- und Urinuntersuchungen zum Einsatz. Sie geben Hinweise darauf,
- welche Ursachen dem geschwächten Herzen möglicherweise zugrunde liegen,
- ob bestimmte Begleiterkrankungen, beispielsweise der Leber oder Niere, vorliegen,
- wie fortgeschritten die Herzinsuffizienz ist und
- welche Therapie sich eignet.
Die Laborwerte bei Herzinsuffizienz sind hilfreich, um den Schweregrad der Erkrankung einzuschätzen und die geeignete Therapie festzulegen. Bei den laborchemischen Untersuchungen überprüft das medizinische Fachpersonal beispielsweise die Werte von Natrium, Kalium, Calcium, Harnstoff, Kreatinin sowie bestimmten Leberenzymen.

AdobeStock_151707175_ChristArt
Zur Herzdiagnostik gehören auch Blutuntersuchungen.
Eine Blutuntersuchung auf die Herzinsuffizienz-Biomarker BNP (brain natriuretic peptide) und NT pro-BNP (N-terminales pro-BNP) kann die Diagnose der Herzinsuffizienz nach einem EKG weiter erhärten. Dabei handelt es sich um bestimmte Eiweiße (Proteine), die bei einer Überlastung des Herzens vermehrt freigesetzt werden. Zur vollständigen Abklärung nach einem auffälligen EKG und entsprechenden Werten der Biomarken (messbare, biologische Merkmale von Prozessen im Körper) wird häufig ergänzend eine Echokardiographie (Ultraschalluntersuchung) gemacht.
Gut zu wissen: Um den Behandlungserfolg einer Herzinsuffizienz zu überprüfen, wiederholen Ärzte und Ärztinnen regelmäßig die Blutuntersuchung auf Biomarker.
Röntgen-Thorax zur Herzuntersuchung
In einigen Fällen veranlassen Mediziner und Medizinerinnen eine Röntgenaufnahme des Brustkorbs (Röntgen-Thorax). So können sie erkennen, ob
- andere Lungenerkrankungen (beispielsweise Lungenkrebs) die Atemnot verursachen,
- sich Blut in die Lungengefäße zurückstaut oder
- ein Lungenödem vorliegt.
Sinnvoll ist die Methode zur Herzdiagnostik zudem bei Personen mit Verdacht auf eine akute Herzinsuffizienz. Sie wollen mehr über die Herzuntersuchung wissen?
Herz-Untersuchungsmethoden, die bei Bedarf angewendet werden
Neben den Standarduntersuchungen können Ärzte und Ärztinnen auf weitere Untersuchungen zurückgreifen. Je nach Patient und Patientin und Symptomatik stehen verschiedene Methoden zur Verfügung.
Herz-Magnetresonanztomographie (MRT)
Für die Herzdiagnostik bei Radiologen und Radiologinnen müssen Patienten und Patientinnen in einer Röhre liegen, während Magnet- und Radiowellen ein Bild von ihrem Herzen erstellen. Die Kardio-MRT gibt Aufschluss über Struktur und Funktionsweise des Herzens und kann beispielsweise Entzündungen des Herzmuskels feststellen.
Herzkatheter-Untersuchung (Koronarangiographie)
Bei Verdacht auf Verengungen der Herzkranzgefäße führen Kardiologen und Kardiologinnen eine Analyse in Form einer Koronarangiographie durch. Diese Methode zeigt, wie die Druckverhältnisse im Inneren des Herzens sind und wie gut die Herzklappen arbeiten. Eventuell bestehende Verengungen, die einen Herzinfarkt auslösen könnten, werden dabei in der Regel erkannt und gleich behandelt.
Myokardszintigraphie
Ebenso hilft die sogenannte Myokardszintigraphie, mehr über die Durchblutung des Herzmuskels und die Herzfunktion zu erfahren. Verengungen der Herzkranzgefäße im Rahmen der koronaren Herzkrankheit können dadurch beispielsweise ermittelt werden. Die Herzuntersuchung erfolgt über einen Computertomographen (CT).
Radionuklidventrikulographie
Die Radionuklidventrikulographie (Herzbinnenraumszintigraphie) gibt Aufschluss über:
- Funktionsweise der Herzkammern (Ventrikel) und Herzklappen
- Wandbewegungen des Herzens
- Blutmenge, die die Kammern pro Herzschlag in den Körper pumpen (Auswurfleistung)
- Geschwindigkeit von Füllung und Entleerung der Kammern
Ähnlich wie bei der Myokardszintigraphie bekommen Patienten und Patientinnen gering radioaktive Substanzen in die Vene verabreicht, um so bestimmte Bereiche des Herzens besonders gut sichtbar zu machen. Bei der Untersuchung werden in Ruhe und unter Belastung (beispielsweise auf dem Liegefahrrad) mithilfe einer sogenannten Gammakamera detaillierte Aufnahmen vom Herzen erstellt.
Neben der Kamera, die Radiologen und Radiologinnen vor der Brust der Patienten und Patientinnen ausrichten, werden Betroffenen bei der Radionuklidventrikulographie auch EKG-Elektroden aufgeklebt. Das EKG ermittelt die optimalen Zeitpunkte für die Aufnahmen, zu denen die Gammakamera dann mehrere Bilder pro Herzschlag aufnimmt.
Die Radionuklidventrikulographie kommt vor allem bei einer vermuteten Herzinsuffizienz zum Einsatz, weil
- eine Herzschädigung (beispielsweise ein Defekt in der Herzscheidewand) vorliegt oder
- eine Aortenklappeninsuffizienz besteht, die Aortenklappe also nicht mehr richtig schließt.
Mittlerweile setzen Mediziner und Medizinerinnen anstelle der Radionuklidventrikulographie zunehmend die Echokardiographie ein. Sie ermöglicht eine ähnlich genaue Darstellung der Auswurfleistung und verläuft ohne Strahlenbelastung für Patienten und Patientinnen.
Lungenfunktionstest (Spirometrie)
Die Spirometrie ist die am häufigsten angewandte Methode zur Überprüfung der Lungenfunktion, denn ihre Auswertung ermöglicht relativ exakte Aussagen über das Lungen- und Atemvolumen sowie die Atemströme der untersuchten Person.5
Die Lungenfunktionsprüfung kann in der Hausarztpraxis oder bei Lungenfachärzten und -ärztinnen durchgeführt werden. Hierbei atmen Patienten und Patientinnen in ein Mundstück, das mit dem Spirometer verbunden ist. Die Nase wird mit einer Klammer verschlossen. Das Gerät misst Stärke sowie Tiefe der Atemzüge und zeichnet die durchströmende Luftmenge und -geschwindigkeit auf. Die beim Lungenfunktionstest gemessenen Werte geben Aufschluss über den Funktionszustand der Lunge.
Die Funktionen von Lunge und Herz hängen unmittelbar zusammen. Eine fortschreitende Herzinsuffizienz kann auch die Lunge in Mitleidenschaft ziehen. Denn wenn die geschwächte linke Herzkammer nicht mehr ausreichend Blut in den Körperkreislauf pumpt, verbleibt das Blut im Herzen und kann sich bis in die Lunge zurückstauen. Der hohe Druck, der durch den Rückstau entsteht, führt zu Wassereinlagerungen (Ödemen) und einer Funktionseinschränkung der Lunge, die Ärzte und Ärztinnen durch die Werte eines Lungenfunktionstests erkennen können. Deshalb ordnen sie in manchen Fällen bei vorliegender Linksherzinsuffizienz eine Lungenfunktionsprüfung an.
Andererseits können auch vorliegende Lungenerkrankungen, beispielsweise COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease; deutsch: chronisch obstruktive Lungenerkrankung), zu einer Herzinsuffizienz führen: Durch die Lungenerkrankung, die durch einen Lungentest nachgewiesen wird, entsteht ein erhöhter Widerstand in der Lunge. Die rechte Herzkammer muss entsprechend stärker pumpen, zugleich staut sich das Blut zurück in die Lungenarterie und die rechte Herzkammer. Sie dehnt sich aus, wodurch sich die Pumpkraft verringert (Cor pulmonale). Es kommt zur Rechtsherzinsuffizienz.
Regelmäßiger Herz-Kreislauf-Check-up
Unabhängig von den Untersuchungsmethoden zur Diagnostik einer Herzinsuffizienz sind regelmäßige Herz-Kreislauf-Checks ratsam – mit, aber auch ohne eine bestehende Herzschwäche. Ab einem Alter von 35 und in einem Intervall von drei Jahren zahlt die Krankenkasse folgende Maßnahmen zur Herzdiagnostik:6,7
- Blutdruckmessung
- Pulsfrequenzuntersuchung
- Abhören der Herztöne
Fallen Ärzten und Ärztinnen dabei Unregelmäßigkeiten auf, können weitere Untersuchungen folgen. Liegen Risikofaktoren wie Übergewicht, Nikotinkonsum, familiäre Vorbelastungen oder Beschwerden wie Atemnot und schnelle Ermüdung vor, entscheiden Mediziner und Medizinerinnen individuell über die weiteren Maßnahmen.
Carotis-Untersuchung
Um frühzeitig Gefäßverkalkungen und somit das Risiko für einen Herzinfarkt zu erkennen, kann eine Carotis-Duplex-Sonographie sinnvoll sein. Dabei führen Ärzte und Ärztinnen einen Ultraschall der Halsschlagader durch.
FAQs: Die wichtigsten Fragen und Antworten zu Herzuntersuchungen
Wie können Ärzte und Ärztinnen eine Herzinsuffizienz feststellen?
Mediziner und Medizinerinnen stellen die Diagnose durch ein Anamnesegespräch, Blut- und Urinanalyse sowie geeignete körperliche Untersuchungen des Herzens, beispielsweise EKG, Herzultraschall oder Kardio-MRT.
Sind Herzuntersuchungen schmerzhaft?
Nein, in der Regel haben Patienten und Patientinnen bei einer Herzuntersuchung keine Schmerzen
Sind Herzuntersuchungen anstrengend für den Körper?
Das kommt auf die Art der Herzuntersuchung an. Ein Belastungs-EKG geht mit erhöhter körperlicher Anstrengung einher, bei der Röntgen-Thorax-Untersuchung ist der Patient oder die Patientin Strahlenbelastung ausgesetzt. Sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Ihrer Ärztin über Vor- und Nachteile der Untersuchungen, wenn Sie sich diesbezüglich unsicher sind.
Sind Herzuntersuchungen gefährlich?
Die Methoden, die bei der Herzdiagnostik zur Verfügung stehen, sind sehr erprobt und sind Routine für Ärzte und Ärztinnen. Trauen Sie sich, im Arztgespräch Bedenken zu äußern.
Was haben Herzinsuffizienz und Lungenfunktion miteinander zu tun?
Sie hängen eng zusammen. Eine Herzinsuffizienz im fortgeschrittenen Stadium kann auch die Lungenfunktion beeinträchtigen. Umgekehrt können Lungenerkrankungen Auswirkungen auf die Herzgesundheit haben. Deshalb wird neben verschiedenen Herzuntersuchungen bei manchen Personen auch ein Lungentest durchgeführt.
Quellen
1 Immanuel Klinikum Bernau. HERZZENTRUM BRANDENBURG. Echokardiographie. URL: https://herzzentrum.immanuel.de/herzzentrum-brandenburg-bei-berlin-leistungen/diagnostik-von-herzerkrankungen/echokardiographie/, zuletzt aufgerufen am 17.02.2025.
2 Arztpraxis Danner: EKG. URL: https://www.arztpraxis-danner.de/ekg.htm, zuletzt aufgerufen am 17.02.2025.
3 Internisten im Netz: Langzeit-EKG. URL: https://www.internisten-im-netz.de/untersuchungen/langzeit-ekg.html, zuletzt aufgerufen am 17.02.2025.
4 ebd.
5 Bohlmann, Jantje: Lungenfunktionsprüfung – Was ist das?. URL: https://www.tk.de/techniker/gesundheit-und-medizin/behandlungen-und-medizin/atemwegs-und-hno-erkrankungen/lungenfunktionspruefung-was-ist-das-2022854, zuletzt aufgerufen am 17.02.2025.
6 Deutsche Krebsgesellschaft: Der Check-up 35. URL: https://www.krebsgesellschaft.de/onko-internetportal/basis-informationen-krebs/vorsorge-und-frueherkennung/der-check-up-35.html, zuletzt aufgerufen am 17.02.2025.
7 Bundesministerium für Gesundheit: Gesundheits-Check-up. URL: https://www.bundesgesundheitsministerium.de/checkup.html#:~:text=K%C3%BCnftig%20haben%20gesetzlich%20versicherte%20Frauen,Anspruch%20auf%20eine%20%C3%A4rztliche%20Gesundheitsuntersuchung, zuletzt aufgerufen am 17.02.2025.

